Hohenems festigt seinen kontroversellen Ruf mit planmäßigen Aufregungen um die Errichtung seines Stadtsaals. Der geplante Standort an der Stelle des baufälligen Gasthofs Löwen, die Saalgröße, aber auch die Gestaltung selbst sind Gegenstand mehr oder weniger qualifizierter Kampagnen, denen aber zumeist etwas von Theaterdonner anhaftet.
Wer sich nicht mit dem Anblick des Schauspiels aus der Ferne begnügt,
und die "Heldentenöre" etwas zur Seite schiebt, stößt in
Hohenems auf eine Reihe von weit vernetzten Initiativen, die zum Teil seit
vielen Jahren engagierte Arbeit leisten. Was dabei auch zu Tage tritt, sind
ernst zu nehmende Themen und hierorts sich etwas schärfer abzeichnende
Problematiken, die aber allesamt symptomatisch sind für die Gemeinden
des Rheintals:
Stadtentwicklung versus Dorfidylle, Raumplanung als Schwarzer Peter der Region und das Auseinanderdriften von kulturellen Identitäten.
Inhalt:
> Die Stadt als Abbild kultureller und gesellschaftlicher Energien.
> Infrastrukturen als neue Zentren
> Über Häuser im Kopf und die Ökonomie des Bodens.
> Die verlorene Bürgerlichkeit
> Verlust und Wiederentdeckung
> Mühevolle Stadtwerdung
> Urbane Netzwerke
> . . . und jetzt, was ist mit dem neuen Stadtsaal ?
> Kulturkampf am Schlossplatz
> Bauen als öffentliche Angelegenheit
kommentar - ausfahrten leser forum >
Die Stadt als Abbild kultureller und gesellschaftlicher Energien.
Ein häufig zu hörendes Argument in formalen Fragen der Architektur ist die Sorge um das Historische, die Sorge um das „Bild“. Doch das malerische Stadtbild ist eine Erfindung des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts. Dabei wird freundlich ausgeblendet, dass visuelle Präsenz zumeist eine Frage der Macht ist und sich Gebäude und Plätze entsprechend den Wechselfällen des Zufalls und der Geschichte immer in einem Prozess der Wandlung befunden haben. Nur außergewöhnliche kulturelle Homogenitäten oder Machtkonzentrationen haben zusammenhängende gestalterische Ordnungen hervorgebracht. Bis heute ist das bauliche Erscheinungsbild Zeichen kultureller und gesellschaftlicher Energien: Kinozentrum und Fastfoodrestaurant als Ergebnis aktiver Konsumgewohnheiten, die Kirche als Ausdruck klerikaler Macht, der Palast als Wertschätzung einer feudalen Hochkultur.
Infrastrukturen als neue Zentren
Die Kombination aus Kirchplatz und Dorfgasthaus sind als gesellschaftlicher Mittelpunkt zurückgetreten. Die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche und das Diktat der großen Zahl hat Infrastrukturen zu den neuen Zentren unseres Alltags gemacht. Ein Printmedium, das täglich 80% der Vorarlberger Bewohner erreicht, eine Autobahn, die 200.000 Menschen innerhalb von 30 Minuten kurz schließt, sind als Kommunikationsmedien - und das waren Dorfplätze früher - ungleich effektiver. Am Hohenemser Schlossplatz ein Seminar- und Tagungszentrum zu errichten, wäre ein extrem mühseliges Unterfangen. Die ortlose Architektur der kürzlich errichteten Autobahnraststätte hat das so reibungslos in sich aufgenommen, dass es kaum wahrgenommen wurde. Das Kinozentrum an der Autobahnabfahrt mit Mehrfachgastronomie oder der Baumarkt mit 10.000m2 Verkaufsfläche sind in den geistigen Landkarten vieler Jugendlicher und der einfamilienhausbewehrten Do-it-yourself-Generation ungleich tiefer eingegraben als die Hohenemser Marktstrasse. Im Konkurrenzkampf der Gemeinden um Steuereinnahmen und Frequenz ist der geplante Ausbau der Rheinauen zum Erlebnisbad eine logische Ergänzung zum schnell gewachsenen neuen Zentrum an der Peripherie.
Die Menschen wieder zu den alten Zentren bekehren zu wollen, käme hoffnungsloser Weltverbesserung gleich. Die Innenstädte sind für diese Nutzungen natürlich keine Alternative, dennoch spielt es eine Rolle, wie weit deren spezifische Möglichkeiten erkannt und gefördert werden.
Über Häuser im Kopf und die Ökonomie des Bodens.
Als großes Hindernis in der Nachverdichtung und der Aufwertung von Kernbereichen zeigt sich die Vorstellungswelt vieler Grundeigentümer, aber auch des Gesetzgebers. Wer ein freies Stück Boden besitzt, geht davon aus, dass er oder seine Nachfahren darauf ein „Hüsle“ bauen werden, ganz gleich, ob dieses Stück Land mitten im Ried oder an einer Hauptverkehrsstraße liegt. Als die Hohenemser Stadtplanung Kontakt aufnahm mit den Eigentümern eines unbebauten Wohngebiets unmittelbar am Autobahnzubringer, hatten einige die Errichtung einer Lärmschutzwand erwartet. Die letztendlich durchgeführte Umwandlung in eine geschlossene, mehrgeschossige Bauweise war anfangs unvorstellbar und brauchte geduldige Überzeugungsarbeit. Im Hinblick auf etwaige Diskussionen über das Rheintal scheint die mangelnde Vorstellung der Vorarlberger von hochwertiger Verdichtung ein zentrales Vermittlungsproblem zu sein.
Dieser Erwartungshaltung entspricht auch das Vorarlberger Baurecht und nimmt in zahlreichen Vorschriften - Grenzabständen, verpflichtenden Parkplätzen, etc. - das freistehende Einfamilienhaus vielfach zum Maßstab. Der ungebrochen hohe Wert von Eigentumsrechten im Vergleich zu kommunalen und gesamthaften Anliegen stellt auch Hohenems vor gewaltige Probleme. Geschlossene Bebauung zu ermöglichen, ist nur unter besonderen Voraussetzungen möglich. Die Hohenemser Stadtplanung hat hier zum in Vorarlberg unüblichen Mittel des Bebauungsplans gegriffen, um für kritische Gebiete konkrete Bebauungsvorschriften zu entwickeln. Nach der Diepoldsauer Straße (ein Wohn- und Gewerbegebiet am Autobahnzubringer) und Emsreutte wird ein solcher Teilbebauungsplan für die Innenstadt erstellt und lässt eine Lösung erwarten, um diese Kerngebiete wieder für den zweifellos vorhandenen Bedarf nicht nur verfügbar, sondern auch durch eine sukzessive Aufwertung interessant zu machen.
Die verlorene Bürgerlichkeit
Die oben genannten Gründe und die komplizierten Eigentumsverhältnisse sind Ursachen für den schon Jahrzehnte andauernden Verfall der Hohenemser Altstadt. Dazu kommt eine mangelnde Identifikation mit einer Bausubstanz, die in einer zwar kleinstädtischen, aber bürgerlichen Tradition entstanden ist. Deren Träger waren zu einem guten Teil Hohenemser Juden, die schon Mitte des 19. Jahrhunderts abzuwandern begannen. Dieser vorerst halb freiwillige Exodus, begünstigt durch die Freizügigkeit des 1867 eingeführten Staatsgrundgesetzes, verkleinerte innerhalb von etwa 10 Jahren die jüdische Gemeinde von rund 550 Personen auf ein Drittel, führte 1912 zur Schließung der jüdischen Schule und fand in der Auflösung und Deportation der verbliebenen jüdischen Gemeinde 1938 seinen gewaltsamen Abschluss.
Verlust und Wiederentdeckung
Die mangelnde Instandhaltung vieler Häuser und deren oft spekulative Vermietung an MigrantInnen, die den Substandard der Gebäude noch akzeptierten, hatten nicht nur das ehemalige Jüdische Viertel, sondern auch die Marktstrasse – ehemals „Christengasse“ – in einen desaströsen Zustand gebracht. Seit 1989 die öffentliche Diskussion um das 1994 letztlich abgebrochene „Bernheimer-Haus“ entstand, hat sich einiges verändert. Die Eröffnung des Jüdischen Museums 1991 hat die Aufmerksamkeit sukzessive auf die historische Bedeutung des gesamten Areals gelenkt und die turbulente Einführung des Ensembleschutzes 1993 für das ehemaligen jüdische Viertel durch das Bundesdenkmalamt hat verschiedene Entwicklungen ausgelöst. Zum einen hat das Jüdische Museum eine intensive und erfolgreiche Informationsarbeit zur Vermittlung des kulturellen Erbes der in Vorarlberg einzigen jüdischen Gemeinde begonnen, zum anderen wurden die Grundlagen geschaffen für die schließlich von Gerhard Lacha in privater Initiative durchgeführten Renovierungen des Elkan-Hauses (1997) und vier weiterer Gebäude. Der zur Zeit stattfindende Umbau der ehemaligen Synagoge zu einer Musikschule und deren gestalterische Wiederherstellung finden ebenfalls auf sein Betreiben statt. Der kommerzielle Hintergrund dieser Initiativen erregte mitunter neidvolles Murren, kann aber angesichts der bisherigen Resultate und der nicht unerheblichen Risiken, die mit der Sanierung denkmalgeschützter historischer Bauten verbunden sind und dem Einverständnis des Denkmalamtes als erfolgreiche Lösung betrachtet werden.
Stärkung der Substanz und der Blick auf die Region.
Potential der Stadtkerne - Mühevolle Stadtwerdung
Verschiedene kompetente Studien zur Stadtentwicklung von Hohenems hatten auf die Bedeutung dieses innerstädtischen Kerngebietes hingewiesen und zum Teil sehr konkrete Vorschläge erarbeitet:
Bebauungsstudie Innenstadt (1975), Rahmenplan Stadtmitte (Scheible 1992), ein Verkehrskonzept (1997) und ein räumliches Entwicklungskonzept (2003) des Büros Metron und schließlich der Städtebauliche Ideenwettbewerb und Studien zum historischen Stadtkern von 1998 bis 2000 (Czech, Märkli, Wiederin, Gnaiger, Meili). Dazu kommt aktuell eine Kulturstrategie der Kulturmanagerin Dr. Eva Häfele, die auch in die Bedarfsermittlung zum neuen Stadtsaal einbezogen wurde. Diese Grundlagen sind zwar intern präsent, finden aber in der Umsetzung und den Turbulenzen der Hohenemser Tagespolitik ihre Grenzen.
All diese Arbeiten attestieren Hohenems ein überdurchschnittliches Potential und weisen relativ einheitlich auf die Bedeutung von Kultur und Dienstleistung hin. Wie Bregenz - mehr geschoben als gegangen - nur durch die beherzte Initiative Einzelner den Weg zur Errichtung des Kunsthauses beschritten hat, so wird auch Hohenems nur durch entschiedene Beharrlichkeit und einem deutlichen Bekenntnis zum Thema Kultur zu entsprechenden Einrichtungen finden. Allzu euphorische Umarmungen von Kulturinitiativen durch offizielle Einrichtungen sind ja bekanntlich deren sicherer Untergang und als solches auch nicht zu erwarten. Insofern wäre ein Transmitter-Veranstaltungszentrum am Schlossplatz für beide Seiten der verkehrte Weg.
Urbane Netzwerke
Der Vergleich ist zwar nur bedingt zulässig, aber auch die Wiener Innenstadt war Ende der 70er Jahre von wachsendem Verkehr, Stadtflucht und baulichem Verfall bedroht, bevor die Rückeroberung durch den Fußgänger und nicht zuletzt durch die (Sub-)Kultur dem Zentrum schließlich zu einem neuen kulturellen und wirtschaftlichen Selbstverständnis verholfen hat.
Wenn Urbanität nicht an Häuserschluchten und endlosen Straßenzügen festgemacht wird, sondern als die Gleichzeitigkeit und produktive Durchdringung unterschiedlichster Netzwerke gesehen wird, kann man in Vorarlberg einiges an Urbanität erkennen. Hohenems hätte mit seinen lebendigen Kulturinitiativen einiges dazu beizutragen. Das jüdische Museum beispielsweise hat genauso wie die Schubertiade oder das Transmitter-Festival so viele überregionale Anknüpfungspunkte, dass ihre Wirksamkeit und Bedeutung nicht nur an Hohenems gemessen werden kann. Wenn die Stadtpolitik diese als Bedrohung einer Idylle wertet, und ihnen nur widerwillig einen Platz im Stadtbild einräumt, werden Kulturkämpfe um eine traute Dörflichkeit weiter an der Tagesordnung bleiben und viel dieser Energien blockieren.
. . . und jetzt, was ist mit dem neuen Stadtsaal ?
Die bisherigen Ausführungen mögen als Kontext gelten, um sich dieser Frage sinnvoll zu nähern. Die Definition des Schlossplatzes im Zusammenhang mit der gesamten Innenstadtentwicklung stünde sicher am Beginn und die Klärung des Bedarfs wäre der nächste Schritt. Mit diesen Vorgaben und dem Bewusstsein über die Bedeutung des Projekts hätte dann ein Wettbewerb zur Erlangung eines Entwurfs durchgeführt werden können. In diesem Fall wurde genau der umgekehrte Weg beschritten.
Der Gestaltungsbeirat, erst nach erfolgter Ausschreibung des geladenen Wettbewerbs zugezogen, protestierte zwar, hat sich sonst aber mit seiner kommentierenden Rolle beschieden. Eine nachdrückliche Beratung in Fragen der Durchführung hat hier offenbar gefehlt oder wurde ignoriert.
Die erste Phase hat den Umgang mit dem Bestand offengelassen und die Architekten Drexel, Spagolla und Huber haben grundverschiedene Lösungsansätze gebracht. Totalabriss, Teilerhalt und eine Renovierung. Daraufhin wurde der Abbruch des Kopfbaus und der Erhalt des Saals als Grundlage für eine weitere Überarbeitung festgelegt, um im Anschluss an die Juryentscheidung für den Entwurf von Arch. Drexel wieder verworfen zu werden. Daraus resultierte dann der Entwurf für ein neues Gebäude, das der alten Raumaufteilung folgt, die angesichts seiner Bedeutung als Eckgebäude noch zu hinterfragen wäre.
In der Vorgangsweise und Diskussion um die Planung des Stadtsaals wurde der Fokus viel zu eng gestellt und erst im Nachhinein langsam erweitert, als man sah, dass die Vorgaben nicht die gewünschten Resultate brachten.
Kulturkampf am Schlossplatz
Die entnervten Architekten wurden quasi im Kreis geschickt und jetzt gerät jede noch so sachliche Argumentation rasch ins Fahrwasser von kulturideologischen Grabenkämpfen. Alt - Neu, da- dort, Hohendisney oder Glaskisteninvasion.
Dennoch. Dieses neuralgische Grundstück am Angelpunkt von Marktstrasse-Jüdischem Viertel und dem Schlossplatz ist ein strategisch zentraler Punkt im öffentlichen Raum der Stadt. Eine möglichst öffentliche Nutzung wirkt auf beide Bereiche und definiert ihren Zusammenhalt.
Der Standort des Stadtsaals ist auch Ausdruck der Stellung des Gemeinwesens. Nach außen für den Besucher, aber vor allem auch als Signal für die Hohenemser. Im Präsentationsbereich von Kirche und Palast wäre eine Präsenz der Gemeinde, vielleicht auch so etwas wie einer Bürgerlichkeit, eigentlich selbstverständlich. In der zweiten Reihe oder sich gar verschämt am Stadtrand zu scharen, wäre eine Kapitulation des öffentlichen Lebens vor einer undefinierbaren Historie.
Bauen als öffentliche Angelegenheit
Der Fehler, Gebäude von öffentlichem Interesse rasch „hinbiegen“ zu wollen, um möglichst wenig Wind und Kosten zu erzeugen, kommt auch im „Architekturwunderland Vorarlberg“ vor. Auf jeden Fall ist es riskant und ein nachhaltiger Verlust an Chancen für ein ganzes Umfeld. Was mit der Studie „Ein Viertel Stadt“ eine qualifizierte Aufbereitung erfahren hatte, fand hier - so ist zu hoffen - nur eine Unterbrechung.
Eine Reihe von positiven Beispielen zeigt, wie aus einer Bauaufgabe ein Landmark, ein Identifikationspunkt werden kann, oder wie Synergien für eine Reihe von Funktionen entstehen. Das Veranstaltungszentrum „Am Bach“, der Lustenauer Marktplatz, aber auch die Gemeindezentren von Schoppenau oder Thal mögen hier genannt sein. Wer das Bauen auf technische oder kaufmännische Fragen beschränken will, verkennt schlicht die Realität.
Warum wurde kein offener Wettbewerb um diesen so städtebaulich sensiblen Punkt durchgeführt, der ein breiteres Spektrum an Lösungen gebracht hätte? Einen vermeintlichen Informationsvorsprung der drei eingeladenen Architekten anzuführen, die bereits mit Planungen am Schlossplatz befasst waren, käme einer Verhöhnung des Architektenstandes gleich.
Wenn das anstehende neue Verkehrskonzept zu einer notwendigen Neubewertung und Gestaltung der Stadtplätze führt, und diese noch weitreichenderen Themen auch in dieser Vorgangsweise angegangen werden, dann steht Hohenems nicht nur ein Nibelungensaal, sondern eine veritable Götterdämmerung ins Haus.
Robert Fabach
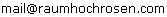
*